Umzug in ein neues Land
Der Umzug nach Deutschland kann für einige der Pflegefachpersonen, die sich dieser Herausforderung stellen und den Anerkennungsprozess in Deutschland durchlaufen, bedeuten, dass sie ihre Familie zunächst im Herkunftsland zurücklassen müssen. Für Arbeitgebende ist es wichtig, sich dies deutlich zu machen und von Beginn an sensibel für diese besondere Situation und gegenüber den eingereisten Pflegefachpersonen zu sein. Denn die Bleibeperspektive und somit auch der langfristige Verbleib im Unternehmen kann entscheidend mit dem Nachzug der Familie zusammenhängen und inwiefern es einem Unternehmen gelingt, auf dieses Thema einzugehen. Ein unterstützendes Umfeld kann dabei eine entscheidende Rolle spielen: Es fördert nicht nur das Wohlbefinden der neuen Mitarbeitenden, sondern macht das Unternehmen auch attraktiver. Arbeitgebende, die den Familiennachzug als wichtigen Bestandteil der Integration verstehen und aktiv begleiten, schaffen bessere Voraussetzungen für eine langfristige Zusammenarbeit.
Familiennachzug: Rechtliche Grundlagen
Der Familiennachzug ist ein zentraler Bestandteil der sozialen Integration und zugleich ein strategisches Instrument zur Stärkung der Mitarbeitendenbindung und -motivation.
Allerdings ist er an einige gesetzliche Vorgaben geknüpft.
Ein wesentlicher Aspekt ist die Sicherung des Lebensunterhalts für die gesamte Familie. Dabei muss das Gesamteinkommen einen bestimmten Mindestnettobetrag erfüllen, damit die Lebenshaltungskosten auch ohne staatliche Unterstützung gedeckt werden können. Dieser Betrag steigt mit jedem weiteren Familienmitglied. In vielen Fällen reicht insbesondere das Nettogehalt einer Pflegehilfskraft nicht aus – vor allem, wenn auch die Mietkosten in die Bedarfsberechnung einbezogen werden. Angesichts der angespannten Wohnraumsituation ist bezahlbarer Wohnraum ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
Zudem muss eine Fachkraft im Anerkennungsverfahren gemäß § 16d AufenthG über ausreichend Wohnraum für alle nachziehenden Familienangehörigen verfügen. Die Wohnfläche wird dabei nach Anzahl und Alter der Haushaltsmitglieder bemessen.
Auch wenn der/die nachziehende Partner:in grundsätzlich in Deutschland arbeiten darf und zum Familieneinkommen beitragen kann, sollten weitere Herausforderungen mitgedacht werden. Dazu gehört beispielsweise auch der Zugang zu Kinderbetreuung. In vielen Regionen sind Kita-Plätze knapp und die Suche nach einem geeigneten Platz erfordert oft eine gewisse Vorlaufzeit. Hier können Arbeitgebende aktiv Informationen über Betreuungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote bereitstellen, um neu ankommenden Mitarbeitenden zu entlasten und Möglichkeiten aufzuzeigen.
Integrationsmanager:innen können neue Mitarbeitende dabei unterstützen, sich im komplexen Verfahren des Familiennachzugs besser zurechtzufinden – etwa, indem sie erste Informationen bereitstellen und bei Bedarf an zuständige Beratungsstellen oder Behörden weitervermitteln. Ein grundlegendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen kann dabei hilfreich sein. Es ersetzt jedoch oftmals nicht die persönliche Beratung und Begleitung bei beispielsweise der korrekten Bearbeitung von behördlichen Dokumenten. Weiteres hierzu finden Sie im Anforderungsfeld „Vorbereitung nach der Anwerbung“
Die gesetzliche Grundlage des Familiennachzugs wird im §27 ff AufenthG geregelt. Dabei wird zwischen dem Nachzug von EU-Bürger:innen und Drittstaatsangehörigen unterschieden. Eine verständliche Erklärung der Gesetzestexte finden Verantwortliche auf den Seiten der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge widmet sich diesem Thema.
Die Plattform make-it-in-germany bietet international ausgebildeten Pflegefachpersonen Informationen rund ums Thema Erwerbsmigration sowie ebenfalls zum Thema Familiennachzug.
Im Rahmen eines DKF Online-Impulses zum Thema „Familiennachzug als wichtiger Bestandteil der sozialen Integration international angeworbener Pflegefachpersonen“, der sich an Integrationsmanager:innen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie Multiplikator:innen richtet, ist eine Videoaufzeichnung entstanden.
Disclaimer: Die genannten Informationen in diesem Online-Impuls dienen lediglich der Information. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Rechtsberatung. Das DKF übernimmt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und haftet nicht für die Richtigkeit der Angaben. Auch auf den Inhalt externer Websites hat das DKF keinen Einfluss, eine Haftung ist ausgeschlossen.
Online-Impuls
Das DKF hat einen Online-Impuls zum Thema „Familiennachzug als wichtiger Bestandteil für die soziale Integration von international angeworbenen Pflegefachpersonen“ erstellt. Hier können Sie einen Überblick zu wichtigen Aspekten erhalten:
Familiennachzug bereits im Anwerbeprozess kommunizieren
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verpflichtet Arbeitgebende und Personalvermittlungsunternehmen dazu, Auswahlverfahren diskriminierungsfrei zu gestalten. Dies gilt auch für Arbeitnehmende aus dem Ausland. Fragen nach dem Familienstand oder einer (geplanten) Schwangerschaft sind im Anwerbeprozess nicht erlaubt. Weitere Informationen hierzu bietet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Zudem dürfen Personalvermittlungsunternehmen personenbezogene Daten von Kandidat:innen nur mit deren Einverständnis weitergeben.
Bereits im Anwerbeprozess ist es wichtig, das Thema „Familiennachzug“ anzusprechen und transparent darüber zu informieren. Das AGG verbietet zwar direkte Nachfragen zur familiären Situation, jedoch können Unternehmen durch diskrete Signale – etwa durch Informationsmaterialien zum Familiennachzug – Bewerber:innen mit Familie willkommen heißen. Wenn über Personalserviceagenturen rekrutiert wird, können diese Materialien auch an die Agenturen weitergegeben werden, sodass sie den Bewerber:innen zur Verfügung stehen.
Es ist jedoch zu beachten, dass das bloße Informieren über den Familiennachzug nicht bedeutet, dass das Unternehmen bereits über die nötigen internen Strukturen verfügt, um eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Der Hinweis auf den Familiennachzug im Anwerbeprozess sollte daher nicht mit einem tatsächlichen familienfreundlichen Arbeitsumfeld verwechselt werden. Um als familienfreundliche Arbeitgebende wahrgenommen zu werden, müssen entsprechende Strukturen wie flexible Arbeitszeiten, Betreuungsangebote und unterstützende Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen werden. Orientierung bietet hier das Audit „berufundfamilie“
Vernetzung mit anderen Akteuren
Bis die Familie ebenfalls in Deutschland angekommen ist, kann viel Zeit vergehen, da der Nachzug erst mit dem Erwerb der vollständigen Berufsanerkennung in die Wege geleitet werden kann. Außerdem ist zu beachten, dass auch Familienangehörige im erwerbsfähigen Alter nach deren Einreise Arbeit und Wohnraum in Deutschland benötigen. Aus diesen Gründen ist es für Arbeitgebende neben der Etablierung eines nachhaltigen Integrationsmanagements im eigenen Unternehmen enorm wichtig, sich gut mit lokalen und regionalen Akteur:innen zu vernetzen. Ein gut ausgebautes Unterstützungsnetzwerk kann dabei helfen, dass sich die international angeworbenen Pflegefachpersonen in der Zeit bis zum Nachzug der Familie in Deutschland zugehörig und wohlfühlen sowie ihre Fragen, Sorgen und Ängste aufgefangen werden. Gleichzeitig bilden sie wichtige Anlaufstellen oder sogar potenzielle Arbeitgebende für die nachziehende Familie. Beispielhaft werden hier einige Akteur:innen genannt:
- IQ-Landesnetzwerke
- Migrationsberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände und andere zivilgesellschaftliche Akteur:innen
- Digitale Migrationsberatung mbeon
- Migrant:innenorganisationen vor Ort
- Kooperationen mit anderen Krankenhäusern und Pflegereinrichtungen
- Sprachschulen
- Kommune
- Wohnungsgenossenschaften o.ä.
Kontakt halten – Möglichkeiten während der Anerkennung
Die lange Trennung von Familie und Freund:innen im Herkunftsland kann den neu eingereisten Kolleg:innen gerade in der Anfangszeit nach der Einreise schwerfallen und für Heimweh sorgen. Die damit verbundenen Gedanken und Gefühle wirken sich erheblich auf das Wohlbefinden aus, welches wiederum das Arbeitsvermögen beeinflussen kann. Das wiederholte Einfühlen in die Situation der neu-eingereisten Kolleg:innen ist für Arbeitgebende besonders wertvoll, um diese beim Halten der Kontakte bestmöglich zu unterstützen.
Trotz fehlender Möglichkeiten eines direkten Familiennachzugs während des Anerkennungsprozesses können Arbeitgebende die eingereisten Pflegefachpersonen dennoch unterstützen. Beispielsweise helfen bereits Kleinigkeiten, wie eine gut funktionierende und stabile Internetverbindung in der Unterkunft und der Zugang zum deutschen Handy- und Telefoniesystem. Ebenfalls können Einrichtungen frühzeitig darüber nachdenken, ob es für die Pflegefachpersonen ermöglicht werden kann, nach deren Berufsanerkennung einen längeren Familienurlaub zu nehmen, damit sich die Reise ins Herkunftsland auch lohnt und nicht auf ein oder zwei Wochen begrenzt ist. In einigen Ländern wird ohnehin von Arbeitnehmenden verlangt, den Jahresurlaub am Stück zu nehmen. Daher ist dieses Thema ein weiteres, über das es sich zu sprechen lohnt.
Das Wichtigste
für Ihre To-Do-Liste
Reflektieren Sie die herausfordernde familiäre Situation der Pflegefachpersonen und sprechen Sie aktiv über ihre Vorstellungen, Wünsche und ihre individuellen Unterstützungsbedarfe
Informieren Sie sich regelmäßig bei zuständigen Behörden für bestehende Möglichkeiten des Familiennachzugs
Sorgen Sie für gute Kontaktmöglichkeiten (Internetzugang, deutsches Handy- und Telefoniesystem) und fördern Sie soziale Anschlussmöglichkeiten am Arbeitsplatz
Fragen Sie Ihre neuen Kolleg:innen in einem angemessenen Rahmen regelmäßig nach ihren individuellen Unterstützungsbedarfen
Haben Sie Verständnis für die herausfordernde Situation und suchen Sie nach individuellen Lösungen
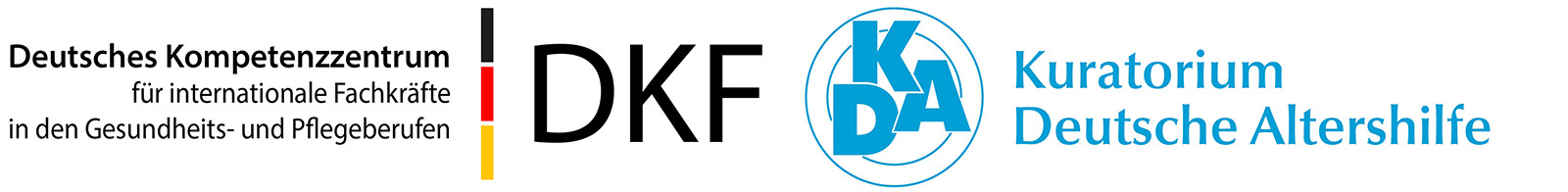

Follow us: